
Mehr als ein Kreuzerl: Wie Jugendliche Demokratie erleben
Was bedeutet es, in einer Demokratie zu leben? Welche Erfahrungen machen junge Menschen mit politischer Teilhabe – besonders dann, wenn ihnen das Wahlrecht fehlt? Und wie lässt sich Demokratie so vermitteln, dass sie nicht abstrakt bleibt, sondern im Alltag spürbar wird? Die neue Folge von Richtig & Falsch geht diesen Fragen nach und beleuchtet, welche Rolle politische Bildung dabei spielt.
Bei der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl 2025 darf etwa jede dritte in Wien lebende Person im Wahlalter aufgrund der Staatsbürgerschaft entweder gar nicht wählen oder ihre Stimme nur bei den Bezirksvertretungswahlen abgeben. In Wien sind das rund 600.000 Menschen. Ein demokratiepolitisches Problem – und ein potentieller Motivationskiller für Kinder und Jugendliche, deren Eltern vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wie demokratische Teilhabe und Wahlen im Klassenzimmer besprochen werden – und was Schülerinnen und Schüler unter Demokratie verstehen – schauen wir uns in der aktuellen Folge von Richtig & Falsch an.
“Was in deinem Alltag hat nichts mit Demokratie zu tun?”
Diese Frage stellt Daniela Ingruber, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Politische Bildung, regelmäßig in Workshops – und löst damit Diskussionen aus, die zeigen, wie eng Demokratie mit dem Alltag verbunden ist. „Und zuerst ist jeder davon überzeugt. Naja, mein Leben hat überhaupt nichts mit Demokratie und auch nichts mit Politik zu tun. Und dann kann man an diesem Beispiel so gut beibringen: Also, was ist jetzt Politik und was ist Demokratie? Und eben, es hat alles damit zu tun.“
Demokratieverständnis beginnt früh – und braucht Raum. Maria Lettner von der Bundesjugendvertretung betont: „Sie erwarten sich das auch, dass sie das Rüstzeug kriegen in der Schule und dass sie Räume haben für Austausch und Diskussionen zu Themen, die ihnen wichtig sind.“
Karlheinz Boss verweist auf die Notwendigkeit, auch mit Frustration umzugehen: “Es gehört dann auch zum Unterricht dazu, dass man lernt, dass nicht alles passiert, was ich will. Es passiert ja nichts, wenn ich einfach nur kurz was aufschreibe: Ich hätte gern.“
Demokratisches Selbstverständnis stärken – auch ohne Wahlrecht
Bei der “Pass Egal Wahl” können Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft symbolisch ihre Stimme für die wienweit kandidierenden Parteien abgeben.
Die Initiative “KUS – für Bildung, Soziales, Sport und Kultur” führt die Pass Egal Wahl auch an Berufsschulen durch. Damit tragen sie dazu bei, den Stimmen der nicht-wahlberechtigten Menschen Gehör zu verschaffen. Gerade wenn das Wahlrecht fehlt, ist es entscheidend, solche symbolischen Beteiligungsformen zu schaffen.
„ Es ist ja natürlich schön, dass man sowas durchführen kann und es ist ja ein super Engagement, aber schlussendlich bleibt dann doch nur die Stimme da und die wird dann gezeigt“, beschreibt Karlheinz Boss vom Verein KUS die Ambivalenz solcher Projekte. Dennoch bleibt die Erfahrung prägend. Matthias Kampl erinnert sich an die Reaktionen von Jugendlichen: „Ah! Das ist Demokratie. Ah! So funktioniert das.“
Demokratie spielen, um sie zu begreifen
Marion Wisinger, Vorstandsvorsitzende des Wiener Forums für Demokratie & Menschenrechte, Chefredakteurin des Liga Magazin für Menschenrechte und Präsidentin des PEN Austria, bringt es auf den Punkt: „Es entsteht in uns allen Unbehagen in einer Diskussion, wenn wir draufkommen, das Gegenüber denkt ganz anders. Und da beginnt aber Demokratie.“
In Workshops und Seminaren wird ganz oft mit Rollenspiel gearbeitet, die das Ziel haben, Empathie zu stärken und eigene Potenziale auszutesten. Daniela Ingruber schildert ein Erlebnis aus einem Workshop: Zwei Söhne von Bürgermeistern übernehmen selbstverständlich die Rolle des Bürgermeisters – und verlieren gegen die Opposition. Erst als ein stilles muslimisches Mädchen die Rolle übernimmt, dreht sich das Spiel: „Und die hat dann alle niedergeredet und mit so phantastischen Argumenten. Und sie ist dadurch auch gewachsen.“
Übrigens: Dieses Rollenspiel fand im Rahmen des Projekts “Was bedeutet Demokratie für mich?” statt. Dieses Projekt hat sogar den Demokratiepreis der Margaretha Lupac Stiftung 2024 erhalten.
Echte Partizipationsmöglichkeiten eröffnen
Ob Jugendmillion oder Schulbibliothek: Dort, wo Jugendliche tatsächlich mitentscheiden dürfen, wird Demokratie greifbar. Auch ohne formales Wahlrecht sammeln junge Menschen hier politische Erfahrung. Bei der Jugendmillion vergeben Jugendliche ein fiktives Budget an echte Projekte. Die Abstimmung erfolgt digital, der Prozess ist transparent. „Es wird wirklich gezeigt: Wie weit sind wir hier schon? Was fehlt dann noch?“, so Karlheinz Boss.
In der Berufsschule Mollardgasse ist am Zentrum für Information und Partizipation der Bestand der Bibliothek zu einem gelungenen Demokratie-Praxis-Projekt geworden. Der Bücherbestand wurde gemeinsam mit den Lehrlingen entwickelt. „Jeder Lehrling kann Vorschläge machen und […] immer wieder schauen, wie steht die Abstimmung und hat mein Buch gewonnen.“ Manche organisierten sogar „Wahlkampf“, um Stimmen für ihren Favoriten zu sammeln.
Tools, Checks und Klartext
Wofür Parteien stehen und welche Ziele sie verfolgen – das ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Schon gar nicht ohne umfangreiches Backgroundwissen.
Viele Jugendliche greifen deshalb auf Online-Tools zurück, um ihre eigenen Positionen mit jenen der Parteien abzugleichen. Bekannt sind etwa die Wahlkabine oder der Wahlrechner. Und für eine Version in leichter Sprache gibt es den Wahlschecker.
Ein besonders zielgruppengerechtes Angebot ist der Jugendcheck der Bundesjugendvertretung. Er basiert auf Fragen, die direkt von Jugendlichen kommen. Die Parteien beantworten diese, und ihre Positionen werden vergleichbar gemacht – mit Daumen hoch, Daumen runter oder klaren Pro- und Contra-Aussagen.
Richtig oder Falsch?
Es ist durchaus richtig, dass wir uns um den Zustand unserer Demokratie kümmern müssen.
Es ist unbedingt notwendig, gute und nachhaltige Politische Bildung zu betreiben.
Es wäre falsch zu denken, dass solche Bemühungen keine Früchte tragen könnten. Das beweisen ja immerhin unsere heutigen Gesprächspartner*innen mit ihren Projekten.
Es ist richtig, dass nicht alle Jugendlichen besonders großes Interesse an Politik haben – in den meisten Fällen liegt das aber am Gefühl, dass auf ihre Meinung auch kein Wert gelegt wird.
Auf jeden Fall ist es falsch zu behaupten, Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge wären unpolitisch.
Oft wissen sie vielleicht selber nur nicht, WIE politisch sie sind.
Zu Gast in dieser Folge sind:
- Daniela Ingruber – Institut für Strategieanalysen, im Vorstand der Interessengemeinschaft Politische Bildung (IGPB)
- Karlheinz Boss – Zentrum für Information und Partizipation, Verein KUS
- Matthias Kampl – Sozialarbeiter an der BS Mollardgasse, Verein KUS
- Maria Lettner – Referentin für Kinder- und Jugendpolitik bei der Bundesjugendvertretung (BJV)
- Marion Wisinger – Historikerin und Autorin, Vorstandsvorsitzende Wiener Forum für Demokratie & Menschenrechte, Chefredakteurin Liga Magazin für Menschenrechte, Präsidentin PEN Austria
Linktipps
- Dossier Wahlen (Zentrum polis)
- Dossier Wahlen (Demokratiewebstatt)
- Dossier Wahlen (Portal Politische Bildung)
- Wahlkabine zur Wien-Wahl
- Wahlchecker zur Wien-Wahl in einfacher Sprache
- Wahlrechner zur Wien-Wahl
- Pass Egal Wahl
- Jugendchecks der Bundesjugendvertretung
- Partizipation von Kindern und Jugendlichen (polis aktuell 4/2021)
- Österreichischer Demokratiemonitor
- Beteiligungsprojekte der Stadt Wien (z.B. Jugendmillion)
- Heiße Themen – cool verpackt! Über den Umgang mit Politik im Unterricht
- Zentrum für Information & Partizipation
- Folge 6: Demokratie in der Schule – Vom Lernen auf Augenhöhe
- Folge 8: Jugend ohne Wahl – zwischen Politikverdrossenheit und Partizipation
- Was bedeutet Demokratie für mich? – Ein CLLD Dolomiti Live Interreg-Projekt zwischen Österreich und Italien
- Der Standard: Mehr als ein Drittel der Wienerinnen und Wiener sind nicht wahlberechtigt
Redaktion: Patricia Hladschik, Nina Schnider, Karl Schönswetter und Johanna Hirzberger
Alle Folgen finden Sie hier.
Richtig & Falsch ist ein Kooperation von Zentrum Polis – Politik lernen an der Schule, der Arbeiterkammer Wien und Demokratie21.
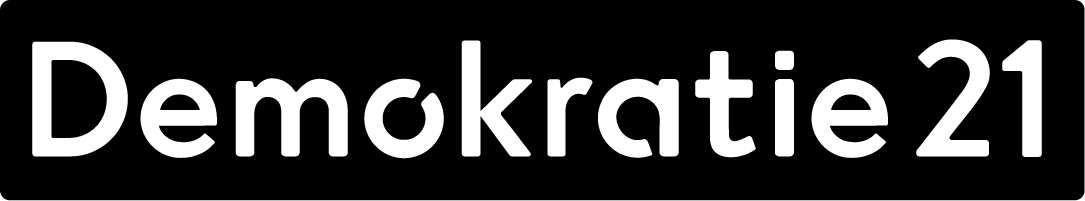

0 Kommentare
Hinterlasse einen Kommentar