
Zukunft lernen – Hoffnung üben: Politische Bildung über die Krise hinaus
Klimakrise, Pandemie, Teuerung – viele Jugendliche kennen nur Dauerkrisen. Das prägt ihre Sicht auf Politik und Zukunft. Politische Bildung kann mehr sein als das Benennen von Krisen – sie kann Wege aus der Ohnmacht öffnen. Hoffnung ist mehr als ein Gefühl – sie ist eine politische Entscheidung.
Wie lernen wir, in Zeiten von Krisen nach vorne zu schauen? Welche Rolle spielen Utopien, Hoffnung und Emotionen in der politischen Bildung? Und wie können Jugendliche im Unterricht Selbstwirksamkeit erfahren – trotz Ohnmacht, Angst und Wut?
Hoffnung als Entscheidung
Philipp Blom beobachtet, dass sich Menschen daran gewöhnen, mit dem Schlimmsten zu rechnen – und die jüngste Vergangenheit zeigt, dass es oft noch schlimmer kommt als befürchtet. In seinem aktuellen Buch beschäftigt er sich deshalb mit dem Bedürfnis nach Hoffnung.
Für mich ist Hoffnung etwas sehr Anderes. Es ist eine Aktivität und es ist eine Aktivität, sich selbst einen Handlungsraum zu schaffen.
Auch Eva-Maria McCormack von der Berliner NGO Talking Hope sieht Hoffnung als politische Kraft. Sie erinnert daran, dass alle großen sozialen Umwälzungen – vom Ende der Rassentrennung bis hin zu Frauen- und Arbeiterrechten – von unten entstanden sind. Veränderung sei möglich, auch wenn Zukunft nicht vorhersehbar ist.
Hoffnung ist für mich kein Gefühl, sondern die Entscheidung, ins Offene zu handeln.
Utopien denken
Für Heinrich Ammerer von der Uni Salzburg beginnt die Zukunft mit Bildern im Kopf – manchmal utopisch, manchmal dystopisch. In seiner Arbeit fragt er: Wie können wir wieder lernen, Utopien produktiv zu denken, ohne sie mit Heilsversprechen zu verwechseln? Denn die totalitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts haben den Begriff beschädigt – und doch brauchen wir Visionen, um die Gegenwart kritisch zu gestalten.
Wir wollen jetzt gewissermaßen diesen Utopiebegriff … wieder rehabilitieren. Weil: Wir brauchen Utopien. Es nützt ja nichts.
Es geht also nicht darum, eine Utopie zu realisieren, sondern sich von ihr inspirieren zu lassen. Als Vision kann sie Orientierung geben – und im Unterricht zum Ausgangspunkt werden, um gemeinsam über eine offene Zukunft nachzudenken.
Eine Zukunft für die Vielen
Wenn es um Hoffnung, Zukunft und Utopie geht, dann geht es auch um Gestaltungsspielräume und Handlungsoptionen – kurz: um die politische Dimension dieser Fragen.
Auch für die Arbeiterkammer Wien ist das ein Kernthema. Deshalb hat sie einen sozial-ökologischen Umbauplan skizziert, der mit Detailreichtum „eine Zukunft für die Vielen“ ermöglichen soll.
Es ist völlig klar, dass eine Utopie sich zu erträumen nicht ausreicht, um Veränderungen zu bewirken, sondern dass man sie schon erkämpfen muss und dass das dann eben auch nicht nur schöne Seiten hat.
Astrid Schöggl
Selbstwirksamkeit erleben
Politische Bildung funktioniert nur, wenn junge Menschen erfahren: Ich kann etwas bewirken. Eva-Maria McCormack betont, dass dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit die Grundlage für jedes Handeln ist – gerade für junge Menschen.
Für Heinrich Ammerer sind Planspiele und Rollenspiele deshalb unverzichtbar, weil dabei die Schüler:innen im Zentrum stehen und erleben, dass ihr Handeln Folgen hat.
Auch Johannes Jordan, Mittelschullehrer in Wien, setzt auf diese Methoden. Als seine Klasse über eine autofreie Straße vor der Schule diskutierte, übernahm ein Schüler bewusst die Gegenposition – zum Gewinn aller. Politische Bildung bedeutet für ihn auch, Themen fächerübergreifend zu behandeln: Fairtrade sei etwa ein ideales Thema, um in Geschichte, Biologie und Ernährungslehre globale Zusammenhänge sichtbar zu machen.
Genau solche Übungen zeigen Schritt für Schritt, was Demokratie heißt: sich informieren, sich eine Meinung bilden, diese Meinung kundtun, das Ergebnis einer Abstimmung akzeptieren – und die Wirkung des eigenen Handelns erleben.
Da sehen die Schülerinnen und Schüler, es bringt was, sich für was einzusetzen.
Johannes Jordan
Wut als Ressource
Die Unsicherheit, die mit dem gegenwärtigen Pessimismus verbunden ist, führt oft zu Wut und Verzweiflung. Wut ist damit ein täglicher Begleiter – ob in den Öffis, im Straßenverkehr oder in den sozialen Medien. Aber wohin mit dieser Wut?
Genau das ist die Frage, mit der sich Hermann Niklas und das Team vom Verein Sapere Aude beschäftigen. In ihren Workshops soll Wut nicht verdrängt, sondern bearbeitet werden. Der Dreischritt: Wut ausdrücken – überlegen, wie eine Welt ohne diese Wut aussieht – und daraus ein positives Gesellschaftsbild entwickeln.
Solange Wut kommunizierbar ist, ist sie auch bearbeitbar und kann … in einen konstruktiven Raum überführt werden.
Mit WUM! – kurz für Wut, Utopie, Manifest – wurde daraus ein digitales Tool. Schülerinnen und Schüler können ihre Wut aufnehmen, Utopien formulieren oder Klassenmanifeste hochladen. In einem Baukastensystem entstehen so gemeinsame Zukunftsbilder.
Immer wieder kreisen die Themen um Sexismus, Rassismus und Gleichberechtigung – die Top drei, egal in welchem Kontext. Spannend ist, dass diese Themen nicht nur in Österreich auftauchen: Auch Jugendliche in Sri Lanka oder Ghana nannten sie als zentrale Anliegen. Besonders Mädchen formulieren den Wunsch nach sicheren Räumen – einfach fortgehen zu können, ohne Angst vor Belästigung oder Bedrohung. Für viele Burschen war das ein Aha-Moment: Erst durch die Diskussion wurde ihnen klar, wie stark solche Erfahrungen den Alltag prägen.
Richtig oder Falsch?
Es ist richtig, dass die Probleme der Gegenwart drängend und ernst sind. Es wäre falsch, dies zu ignorieren und den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist aber auch falsch, sich von der Angst lähmen zu lassen.
Stattdessen ist es wichtig und richtig, sich zu bemühen, gemeinsam Lösungen zu finden. Dafür müssen sich Menschen austauschen und eine gemeinsame Basis finden.
Also:
Zukunftsbilder entwickeln, den Blick weiten und über die aktuellen Krisen hinaus denken. Üben kann man das schon im Unterricht in der Schule.
Zu Gast in dieser Podcast Folge sind:
- Astrid Schöggl (AK Wien, stv. Leiterin der Abt. Klima-/Umweltpolitik & Verkehr)
- Eva-Maria McCormack (Gründerin und Geschäftsführerin von Talking Hope, Berlin)
- Heinrich Ammerer (Arbeitsbereich Geschichts- und Politikdidaktik Uni Salzburg)
- Hermann Niklas (Projektleiter bei Sapere Aude, Schriftsteller)
- Johannes Jordan (Mittelschullehrer. Englisch, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung und Berufsorientierung)
- Philipp Blom (Historiker, Autor, Radiojournalist und Podcaster)
Linktipps:
- Ammerer, H., Anglmayer-Geelhaar, M., Hummer, R., & Oppolzer, M. (Hrsg.): Utopien im Unterricht: Theoretische Verortungen – Fächerperspektiven – praktische Beispiele. Waxmann Verlag, 2024.
- Utopien. Zeitschrift Politikum 2/2018
- Carsten Bünger, Agnieszka Czejkowsk, Ingrid Lohmann, Gerd Steffens (Red.): Zukunft – Stand jetzt. Jahrbuch für Pädagogik 2021. Weinheim Basel: Beltz Juventa, 2022
- Werkzeugkasten: Making Sense of the Future. Zukünfte der digitalen Welt als Unterrichtsthema. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2022.
- Träume. Aus Politik und Zeitgeschichte 15-16/2023. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2023.
- Die Zukunftswerkstatt – eine Methode zwischen Utopie und Realität. Blogbeitrag auf doing geo & ethics | Unterricht digital & analog entwickeln.
- Christian Marker: Zukunftsängste und Weltuntergangsphantasien. Mit Schüler*innen über dystopische Zukunftsvorstellungen nachdenken. In: RPI-Impulse 2/2021.
Plan für den sozialen und ökologischen Umbau | Arbeiterkammer Wien - Co-CreART – Transdisciplinary Lab for Transformation | Mozarteum Salzburg
- Eine andere Welt ist möglich – Über den Nutzen von Utopien in der politischen Jugendbildung
- Talking Hope Link zur Studie zu Gestaltungs- und Veränderungsmacht: What Makes People Act on Climate Change, according to Behavioral Science – Scientific American – By Andrea Thompson edited by Dean Visser
- Vorgestelltes Sapere Aude Projekt “Wut, Demokratie & Beteiligung”
- Wut. Utopie. Manifest! Sapere Aude Workshop und Online-Archiv
- Online-Buchung des Sapere Aude Workshops für Lehrkräfte
- UNESCO Futures Literacy / Future Skills
- Richtig & Falsch, Folge 20: Klimaproteste im Diskurs
- Richtig & Falsch, Folge 28: Männlichkeitsbilder an der Schule thematisieren
- Richtig & Falsch, Folge 18: Radikal? Extremismusprävention im Klassenzimmer
Redaktion: Patricia Hladschik, Nina Schnider, Karl Schönswetter und Johanna Hirzberger
Alle Folgen finden Sie hier.
Richtig & Falsch ist ein Kooperation von Zentrum Polis – Politik lernen an der Schule, der Arbeiterkammer Wien und Demokratie21.
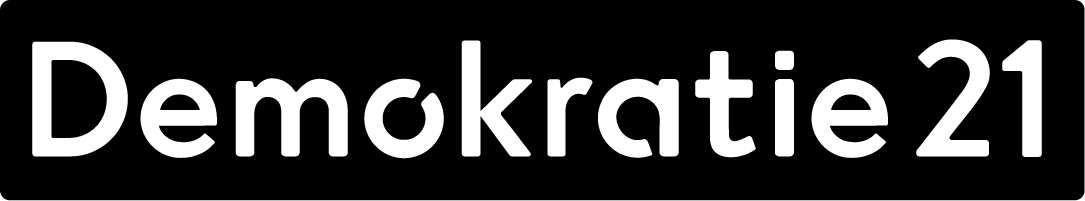

0 Kommentare
Hinterlasse einen Kommentar